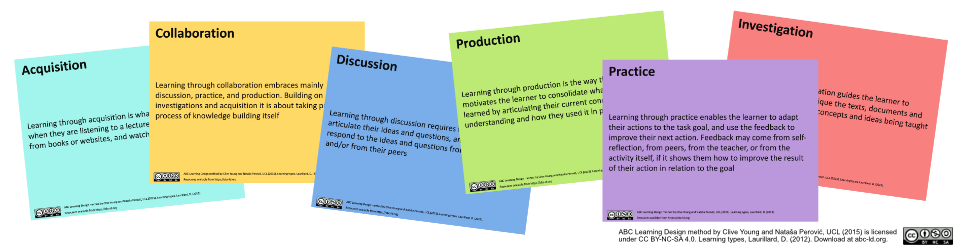Am 24. und 25.04.09 hatte ich die Möglichkeit, an der Forschungswerkstatt von Prof. Peter Baumgartner in Wien zur Frage der Übertragbarkeit des Pattern-Ansatzes von Christopher Alexander in die Didaktik (=> didaktische Entwurfsmuster) teilzunehmen. Prof. Baumgartner hat hierzu schon einen ausführlichen Bericht auf seinem Portal Gedankensplitter zur Verfügung gestellt.
Zunächst muss ich sagen, dass die euphorische Darstellung des Verlaufs der Forschungswerkstatt von Prof. Baumgartner durchaus nicht übertrieben ist – ich habe selbst wenige Veranstaltungen erlebt, in denen über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) eine derart besondere, aktive, analytisch-kreative Atmposhäre herrschte, wie am zweiten Tag der Zusammenkunft – in der Tat ein ‚Flow‘-Erlebnis, das wir als Gruppe erleben konnten. Eine der Voraussetzungen hierfür war – trotz deutlicher Kritk am Pattern-Ansatz von Christopher Alexander und seinen 15 properties of wh0leness aus pädagogischer, psychologischer, philosophischer und methodologischer Sicht – die durch Prof. Baumgartner motivierte Bereitschaft für den Versuch einer Übertragung der 15 properties in die Didaktik. Der Gedankenaustausch, der sich hier frei entfaltete, um Formulierungen und Verständnis ringend, beständig Theorie und pädagogische Praxis miteinander abgleichend, wurde von allen Teilnehmenden als fruchtbar und bereichernd erlebt.
Bei den 15 properties of wholeness handelt es sich um geometrische Struktureigenschaften, die sich nach Alexander in allen als lebendig und ganzheitlich erfahrbaren Strukturen (z.B. in vielen Pänomenen der Natur) wiederfinden. Diese 15 Eigenschaften sind zugleich als strukturerhaltende Transformationen zu verstehen, die zur Entfaltung der ganzheitlichen Strukturen führen. Die 15 properties of wholeness lauten:
- Levels of Scale
- Strong Centers
- Thick Boundaries
- Alternating Repetition
- Positive Space
- Good Shape
- Local Symmetries
- Deep Interlock and Ambiguity
- Contrast
- Gradients
- Roughness
- Echoes
- The Void
- Simplicity and Inner Calm
- Not Separateness
Erläuterungen mit Beispielen zu den 15 Struktureigenschaften finden sich beispielsweise unter http://www.livingneighborhoods.org/ht-0/fifteen.htm.
Grundlegend für unseren explorativen Übertragungsversuch war die (noch zu begründende) Annahme, dass die 15 Struktureigenschaften analog zur Architektur auch in der Didaktik zu lebendigen, ganzheitlichen bzw. kohärenten (didaktischen) Strukturen führen. Vor der Forschungswerkstatt dokumentierte Prof. Baumgartner in einem Weblogeintrag einen ersten Übertragungsversuch der ersten 6 Struktureigenschaften Alexanders. Am zweiten Tag der Forschungswerkstatt vertieften wir diesen Versuch und erkundeten mögliche Entsprechungen in der Didaktik in zeitlicher, räumlicher, sozialer und inhaltlicher bzw. materialbezogener Sicht.
Nachdem ich am ersten Tag nach verschiedenen Diskussionen akzeptiert hatte, dass Alexander scheinbar keine klaren Definitionen der 15 Struktureigenschaften bereithält (z.B. um Fragen zu klären wie z.B. was unter einem Zentrum eigentlich genau zu verstehen ist, oder wodurch sich ein starkes von einem schwachen Zentrum unterscheidet etc.), ließ ich mich einfach mal auf das weitere Vorgehen ein. Der Gedankenaustausch unseres Übertragungsversuchs war dann – wie oben beschrieben – sehr interessant und anregend. Am stärksten hatte mich persönlich das Strukturmerkmal ‚Positive Space‘ angesprochen: Was könnte dieses Merkmal auf die Didaktik übertragen in zeitlicher, räumlicher, sozialer und inhaltlicher Hinsicht alles bedeuten? Zeitlicher Freiraum, der analog zu den Pausen in der Musik nicht einfach Leerraum, sondern gestalteter Raum ist? Unterschiedliche freie Lernräume und -umgebungen, die mehr dem informellen, explorativen, selbstorganisierten Lernen und Arbeiten oder der Erholung dienen (z.B. Erfahrungsräume für Erkundungen, Praktika, Projektarbeiten außerhalb der Schulhauses bzw. der Bildungsinstitution oder auch der Freizeitraum mit dem Kaffeeautomaten, die Bibliothek)? Sozialer Freiraum, der neben der dichten sozialen Interaktion bei Plenums-, Gruppen- oder Tandemarbeit auch Rückzugsmöglichkeiten für das individuelle Arbeiten, Lernen, Reflektieren, Entspannen ermöglicht; ebenso auch soziale Interaktionsmöglichkeiten im formellen Bildungsraum für eher persönliche Interessen (Freundschaften, Cliquen, Beratungslehrer, Tutoren)? Inhaltliche Darstellungen, Materialien und Aufgaben, die denkerischen Freiraum, Kreativität, unterschiedliche Verarbeitungs- und Reflexionstiefe zulassen? Während dieses Prozesses hatten wir zunehmend den Eindruck, dass die anhand der Strukturprinizipien Alexanders zusammengetragenen Gestaltungsaspekte didaktischer Strukturen durchaus bedeutsam für deren besonderer Qualität sein könnten. Ob diese dann auch praktisch, d.h. für die am Lehr-Lernprozess beteiligten Personen, zu einer erlebbaren Quality Without A Name führt, ist allerdings fraglich (QWAN steht nach Alexander für eine intersubjektiv erfahrbare, ganzheitliche und nicht definierbare besondere Qualität lebendiger kohärenter Strukturen).
Ich muss zugeben, dass ich mich bisher nur peripher mit Christopher Alexander beschäftigt habe, wozu vor allem diese Forschungswerkstatt Anlass geboten hatte. Trotz Gedankenfeuerwerk und Flow-Erlebnis – sicherlich auch aufgrund meiner bisher geringen Kenntnisse des Werks Alexanders: Es sind noch viele Fragen offen.
Wie komme ich zu einem wissenschaftlichen Diskurs über Begriffe (15 properties of wholeness), die nicht exakt definiert werden können? In welcher Weise wurden die 15 Strukturmerkmale Alexanders gewonnen, in welcher Relation stehen diese zueinander, wie wird deren Vollständigkeit beansprucht oder nachgewiesen, warum sollten diese als geometrische Struktureigenschaften auf zeitliche, soziale und materialbezogene (didaktische) Strukturen und Prozesse übertragbar sein? Mit welcher Begründung? U.v.a.m. Und dennoch: Irgendwie hat man dennoch das Gefühl, dass bei der Beschäftigung mit dem Pattern-Ansatz und den Strukturmerkmalen Alexanders auch für die Didaktik interessante Ergebnisse gefördert werden könnten. Ist aber auch nur ein Gefühl… Ob das den anderen auch so geht? ;-)