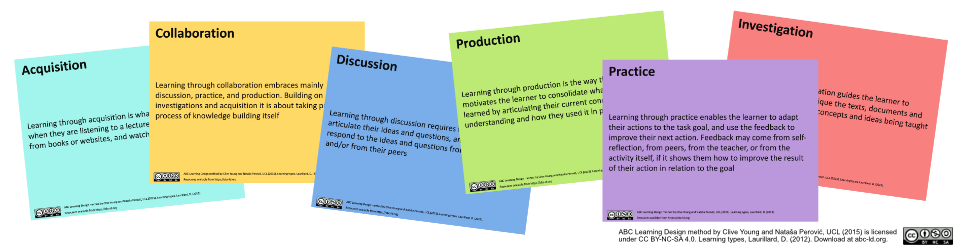In der aktuellen Ergänzungslieferung des Handbuchs E-Learning (26. Erg.-Lfg. Oktober 2008) findet sich ein hilfreicher Beitrag von Daniel Stoller-Schai zur Marktübersicht von WebConferencing-Systemen. Hinsichtlich der Terminologie scheint sich nach Stoller-Schai für synchrone virtuelle Konferenzsysteme (inkl. Audio, Video, Whiteboardfunktionen, Application-Sharing etc.) der Begriff WebConferencing durchzusetzen (S. 3).
Ich persönlich habe in diesem Kontext häufig von Virtual Classroom Tools bzw. Virtual Classroom Meetings und Webinars gesprochen. Zwischen Tool und zugehöriger Veranstaltungsform scheint begrifflich auch ein Unterschied zu liegen. Stoller-Schai schlägt hier vor, den Vorgang selbst im Unterschied zum Tool als E-Meeting zu bezeichnen, das sich in unterschiedlichen didaktischen Formaten ausgestalten kann (vgl. S. 3).
Neben Ausführungen zu methodisch-didaktischen und technischen Aspekten von WebConferencing-Systemen vergleicht Stoller-Schai die Systeme der größten Hersteller anhand von 19 Eigenschaften, die „für den normalen und komfortablen Betrieb von E-Meetings genügen“ (S. 7). Interessant ist die Feststellung, dass sich die Systeme hinsichtlich des Vorhandenseins dieser Eigenschaften/Funktionen nur wenig voneinander unterscheiden, so dass sich die Entscheidung für oder gegen ein System stärker nach anderen Faktoren wie z.B. der Benutzerfreundlichkeit richten wird (vgl. S. 13). Das einzige Open-Source WebConferencing-System eines größeren Herstellers ist übrigens DimDim, das mir schon vor einiger Zeit von Dr. Martin van Kessel empfohlen wurde. Lesenswert sind auch die Trends und Entwicklungen, die von Stoller-Schai bzgl. der WebConferencing-Systeme aufgeführt werden (S. 14). Hilfreicher Überblick mit prägnanten Aussagen und Informationen.