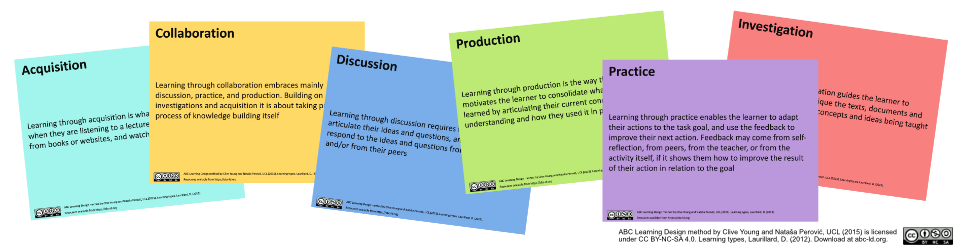Beim Querlesen der jüngsten Artikelsammlung von Stephen Downes, die er unter dem Titel „Toward Personal Learning. Reclaiming a role for humanity in a world of commercialism and automation“ im Juli 2017 publiziert hat, blieb ich beim Artikel „Beyond Institutions Personal Learning in a Networked World“ (S. 347-375) hängen. Downes argumentiert vor dem Hintergrund universitärer Bildungsangebote für individuelles selbstorganisiertes Lernen im Netz (personal learning) quasi als Gegenmodell zu institutionalisiertem Lernen anhand fremdbestimmter Curricula und Instruktionsdesigns.
Auf den Seiten 349-355 rechnet Downes in einer Art Fundamentalkritik mit unterschiedlichsten Prozess- und Produktmodellen im Kontext Management/Education ab (u. a. LMS Selection Model, Learning Design Patterns, Model of how to offer courses, Model of xMOOCs, Specifications LRMI, SCORM). Kern seiner Kritik ist neben der Überfülle an fraglichen oder unnützen Modellen a) die mangelnde kritische Distanz zu Modellen („the model is not the reality“, S. 352) und b) die durch die Wahl eines Modells getroffene Einschränkung auf einen bestimmten Denk- und Erwartungsrahmen bzgl. Lernaktivitäten und Lernergebnissen („If we use these models (…), the design of the model predetermines the structure that defines how we will understand what learning is. We’ve predefined what the outcome will be.“, ebd.).
Nach Downes taugt keines der Modelle zur Unterstützung der wie folgt von ihm verstandenen Bildungsprozesse: „(…) learning needs to be open-ended. Learning needs to be an exploration and a discovery, not the output of predefined, standardized products.“ (ebd.). Daher schließt Downes: „The right model is no model. The right model is to do away with the models.“ (S. 354).
Klar, dass das bei mir verfängt. Habe ich eine ganze Reihe an Modellen im Bereich Instructional Design doch kennen und in der Praxis (inbesondere während meiner Arbeit am E-Learning-Zentrum der Akademie Dillingen) schätzen gelernt (u. a. das Modell der e-Tivities nach Gilly Salmon; das ROME – Rostocker Modell zur Entwicklung von E-Learning-Angeboten nach Sybille Hambach, leider nicht mehr öffentlich verfügbar; Compendium LD – ein Modell und Tool zur Konzeption von E-Learning-Angeboten). Nicht zuletzt haben wir in Kooperation mit Partnern aus dem Arbeitskreis eLiSL unter meiner Leitung selbst ein Qualitätsmodell zur Gestaltung moderierter Online-Seminare enwickelt.
Modelle leisten für meine Erfahrung aus folgenden Gründen wichtige Unterstützung beim Design online-unterstützten Lehrens und Lernens:
- Modelle als Orientierungs- und Strukturierungshilfen für die Design-Praxis: Die oben genannten Modelle zur Gestaltung von E-Learning-Angeboten gaben mir (und unserem Team) wesentlich Orientierung bei der Gestaltung von Online-Lehr/Lernaktivitäten und der systematische Erarbeitung online-unterstützter Kurse. Ohne diese wären unsere Redaktionssitzung unter Einbeziehung entsprechender Fachexperten zu reinen „trial and error“-Veranstaltungen mit deutlich längerer Entwicklungszeit und ungewissem Ergebnis geworden. Zudem spielten Visualisierungshilfen (wie z. B. CompendiumLD) eine wichtige Rolle für die Kurs-Strukturierung und das Erarbeiten von Lehr-Lernaktivitäten im Team.
- Vielfältige Modelle als Grundlage professioneller Design-Praxis: Die Vielzahl an Modellen fand ich – trotz konkurrierender Ansätze – nie erschlagend oder sinnlos. Gerade der kritisch-informierte Umgang mit und die zielorientierte Auswahl von Modellen für unterschiedliche didaktische Anliegen war und ist für mich Grundlage professionellen Handelns als Educational Technologist. Dass viele Modelle eher orientierend und eklektizistisch genutzt werden, liegt im Selbstverständnis einer (praxisorientierten) ID-Community (vgl. etwa Honebein/Sink oder Yanchar/South/Williams/Wilson). Aufschluss über deren Wirksamkeit muss ohnehin über begleitende und/oder abschließende Evaluationen unter Berücksichtigung evtl. Redesign-Zyklen gewonnen werden.
- Modelle als theorieorientierte Reflexionshilfen und Denkwerkzeuge: Modelle liefern mit ihren abstrahierten (weil Komplexität reduzierenden) Beschreibungsversuchen von Wirklichkeit Denkwerkzeuge, mittels derer Sachverhalte systematischer beschrieben und hinsichtlich ihres Wirkungszusammenhangs leichter durchdacht werden können. Damit bilden Modelle eine handlungsleitende, allerdings stets kritisch zu hinterfragende Grundlage für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und die fachliche Diskussion.
Zugestehen muss ich allerdings, dass die Modellverwendung beim Design von Lehr-Lernarrangements auch hinderlich oder kontraproduktiv wirken kann, was mir durch Downes Beitrag wieder bewusster geworden ist.
- Modelle als Denk- und Kreativitätshürden: Einfach mal loslegen und frei von Denkschablonen Ideen für Lehr-/Lernaktivitäten bis hin zu ganzen Kursdesigns skizzieren und mit anderen austauschen können. Das geht nur, wenn nicht schon von Beginn an alles auf bestimmte Modelle und Kursschablonen vorformatiert und ausgerichtet wurde. Begleitend lassen sich in Phasen der Zwischenreflexion immer noch Modellbezüge herstellen (und daraus Anregungen oder Korrektive gewinnen). Viele Lehr-Lernarrangements und Methoden – ob Webquests oder cMOOCs – wären ohne Kreativität und Mut, mal etwas Neues zu probieren, nie entstanden. Daher ist es gelegentlich eine Notwendigkeit, alle Vorstellungen für die konkrete Ausgestaltung eines Lehr-Lerndesigns beiseite zu rücken und mit einem weißen Blatt Papier zu beginnen; oder gar dem Lerner die Gestaltung seines Lerndesigns komplett selbst zu überlassen und nur Entwicklungsanregungen zu geben.
Aber: Ich denke schon, dass wir von der Universität bis zur Schule das von Downes hervorgehobene selbstorganisierte „personal learning“ beim Online-Lernen stärken sollten. Allerdings sehe ich darin eine Lernform neben anderen, die je nach Zielsetzung unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ich würde mich jedenalls nicht wohl dabei fühlen, wenn die Piloten- oder Medizinerausbildung komplett auf Standards verzichtete und ausschließlich in Form selbstorganisierten persönlichen Lernens erfolgte. Dass zudem Modelle gewisse Denk- und Ergebnisrahmen vorgehen, ist beim Design spezifischer Lernangebote genau so erwünscht. Wenn ein Lernangebot in erster Linie Orientierungswissen und an wenigen Stellen Konzeptwissen vermitteln will, ist eben ein anderes Lehr-Lerndesign gefragt, als wenn die Zielsetzung beim Erreichen bestimmter Kompetenzen liegt.
- Modellen als missverstandene Umsetzungsvorlagen: Auch ich ließ mich schon dazu verleiten, interessante Modelle und Theorien als unmittelbare Umsetzungsvorlagen zur Konzeption didaktischer Arrangements zu interpretieren. Hier macht Downes‘ Hinweis „the model is not the reality“ die Begrenztheit und Abstraktion eines Modells gegenüber der Wirklichkeit wieder deutlich und hilft – insbesondere für das Instruktionsdesign – Modelle als Wegweiser und nicht als Umsetzungsschablonen zu verstehen. Selbstverständlich muss auch hier das betreffende Modell stets in seinem Entstehungs- und intendierten Nutzungskontext gesehen werden.
Aber: Mein Eindruck (auch aus zahlreichen Gesprächen mit Lehrkräften aus unterschiedlichen Schularten) im Education-Bereich ist, dass das Denken, Sprechen und Reflektieren von Modellen bei der Unterrichtsplanung meist keine oder eine nur sehr geringe Rolle spielt. Von daher sehe ich eher die Herausforderung, sich überhaupt in der Praxis (und im Team) mit Designmodellen zu beschäftigen, als diese misszuverstehen.
Von daher muss ich Downes‘ provokative Aussage (die er sicherlich augenzwinkernd bewusst überspitzt) für meine Erfahrung verneinen: The right model isn’t no model. Vielmehr gilt für mich: One right model is the critical reflection and adoption of models during an iterative design-implementation-evaluation cycle.